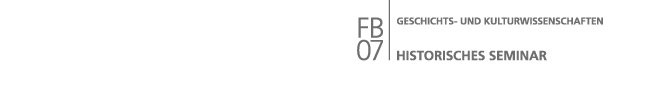Salut tout le monde, es ist noch gar nicht allzu lange her, dass ich hier von meinen ersten Eindrücken und Erfahrungen berichtet habe und trotzdem gibt es wieder eine Menge zu berichten.
Fangen wir mit einem weniger erfreulichen, dafür aber umso wichtigeren Thema an: Es ist nun genau 20 Jahre her, dass sich der Völkermord in Ruanda an der Tutsi-Minderheit ereignet hat. Am 08.10. fand an der Unversité de Bourgogne anlässlich dieses Gedenkjubiläums ein Kolloquium statt, das unter der Frage lief, wie man den Genozid in den letzten Schuljahren und an der Universität an Schüler und Studenten vermitteln könnte.
Der Tag begann mit einer thematischen Einführung von Francois Robinet, einem Dozenten für Zeitgeschichte an der Universität Versailles St-Quentin-en-Yvelines. Hierbei beleuchtete er die Ursachen, Auslöser und Verlauf des Genozids, aber auch die (geo)politischen Folgen desselben.
Als die europäischen Kolonialherren die durch und durch hierarchie strukturierte Gesellschaft der Hutu und Tutsi vorfanden, wollte dies überhaupt nicht mit ihrem Bild vom "Wilden Schwarzen" übereinstimmen,was sie zu der Annahme trieb, dass die Tutsi-Minderheit, die etwas hellere Haut als die Hutus hatte, ursprünglich der "weißen Rasse" angehöre (sog. Hamitentheorie) und damit den Hutus vorzuziehen sei. Vor dieser künstlich erzeugten Unterscheidung, lag der Unterschied zwischen den Bevölkerungsgruppen lediglich in deren Sesshaftigkeit und dem Ackerbau (Hutu) bzw. ihrem Nomadentum und der Viehzucht (Tutsis).
Diese künstlich erzeugte und rassistische Unterscheidung bot den idealen Nährboden für das, was 1994 schließlich im Völkermord an den Tutsis und gemäßigten Hutus durch die Hutus mündete.
Die ruandisch-französischen Beziehungen sind auch heute noch sehr schlecht, da Ruanda Frankreich vorwirft, vor 20 Jahren durch französische Soldaten vor Ort aktiv zum Genozid beigetragen zu haben. Dieses Jahr hat die französische Justizministerin Christine Taubira aufgrund von erneuten ruandischen Anschuldigungen ihre Teilnahme an den Gedenkfeiern abgesagt. Ihr Vertreter vor Ort, der französische Botschafter wurde von den Feierlichkeiten ausgeschlossen.
Auch das war Thema des Kolloquiums, das nach dem Beitrag von Francois Robinet, mit weiteren Vorträgen von u.A. einem Dozenten der Université de la Réunion, einer Lehrerin aus Paris etc. die sich mit der filmerischen und literarischen Darstellung des Genozids beschäftigten, fortgesetzt wurde.
Der Völkermord in Ruanda wird mich während des Semesters noch weiter begleiten, da ich mich in einem Literaturkurs mit afrikanischer Literatur beschäftige. Hierfür lese ich drei Werke von afrikanischen Autoren, die sich mit dem Genozid in Ruanda, dem Algerienkrieg und mit afrikanisch-französischen Soldaten während des zweiten Weltkriegs auseinandersetzen.
Ein weiterer nennenswerter Höhepunkt während der letzten Woche war ein Tagesausflug in die Hauptstadt, Paris. (Ich weiß, dieser Übergang ist mir nicht gelungen 😉 ) Die Region Burgund bietet die Hin-und Rückfahrt von Dijon nach Paris für 20 Euro an- ein super studentenfreundliches Angebot, das ich sicherlich noch ein paar Mal wahrnehmen werde, um noch öfter in Montmartre zu frühstücken und dabei den fleißigen Künstlern zu zuschauen, die bereits mit den ersten Sonnenstrahlen ihre bunt tanzenden Striche auf die Leinwand bringen, oder um am Ufer der Seine entlang zu spazieren, in den Gassen Marais noch mehr zu entdecken, als den lieblichen marché des enfants rouges, wo man übrigens sehr lecker essen kann und von dem es nicht mehr weit ist zur Notre-Dame und dem quirligen Centre-Pompidou und und und!!
Besonders schön an meinem Ausflug war meine Ankunft in Dijon, bei der mich das warme Gefühl überkam, nach einem wunderbaren Tag wieder nach Hause zu kommen.
Zu Hause wartete aber auch eine Menge Arbeit auf mich: So musste ich letzten Dienstag mein allerallerallererstes Referat hier in Frankreich halten- in Alter Geschichte. ( An dieser Stelle ist ein wenig Mitgefühl nicht unangebracht). Grundlage dieser Präsentation war eine Quelle Aristoteles aus seiner staatsphilosophischen Schrift Politique, in der er die spartanischen Institutionen einer philosophischen Kritik unterzieht. Mein commentaire sollte ca. 30 Minuten dauern. Danach musste ich mich der Fragen der Dozentin stellen, womit sie meine französischen Mitstudierenden regelmäßig in Angst und Bange versetzte.
Doch bevor ich mich dem Endgegner Bowser, ähh ich meine Madame Kossmann stellen konnte, musste ich erstmal eine passende Fragestellung entwickeln anhand derer ich den Text analysieren würde. In Frankreich wird strikt auf einen Dreischritt in der Gliederung bzw. der Problematik geachtet. Das heißt es ist darauf zu achten drei Oberpunkte mit je drei Unterpunkten auszuarbeiten. Da ich allerdings der Ansicht war, dass dies der Text Aristoteles' nicht hergeben würde, flüchtete ich in die Bibliothek um Tag und Nacht (außer am Sonntag, da macht die Bib nämlich, warum auch immer Siesta) verstaubte Wälzer zu den Ursprüngen der spartanischen Institutionen zu durchforsten.
Eine weitere Besonderheit dieser Referate ist, dass man einen Text verfasst und diesen dann dem Kurs vorliest und nebenher ein paar Power-Point slides abspielt. Im Klartext hieß das für mich: Ein komplettes Wochenende jegliche soziale Kontakte und Unternehmungen zu unterbinden und mich ganz den Spartanern zu widmen. Der Aufwand hatte sich gelohnt: Ein 3000 Wörter starker commentaire wartete nur noch darauf vorgelesen zu werden. Eine Stunde vor Beginn des Seminars stand mein Referat und war bereit sich dem kritischen Publikum zu stellen.
Prinzipiell habe ich keinerlei Probleme damit, Vorträge vor einer versammelten Menschenmasse zu halten, allerdings haben mich die gezückten Stifte und heißlaufenden Laptops leicht verunsichert, da ich befürchtete, dass mein Referat den französischen Mitstudierenden nicht genug Input liefern würde. Als die ersten Sätze aber gelesen waren, verflogen diese Zweifel und ich wurde von Zeile zu Zeile gelassener.
Auch die Fragen der Dozentin konnte ich allesamt beantworten ( ich hoffe, das sieht sie auch so) 😉 und hatte das Gefühl die Feuertaufe einigermaßen bestanden zu haben. Feedback habe ich keines bekommen, außer einen kleinen Hinweis, dass ich näher am Text hätte bleiben sollen. Möglichkeit dazu werde ich in den nächsten Vorträgen für mein Mittelalterseminar und meinem Kurs zu den Methoden der modernen Geschichte haben. Nach dem Referat ist vor dem Referat oder nach meinem Beitrag ist vor dem Beitrag.
In dem Sinne, bis bald
Filiz