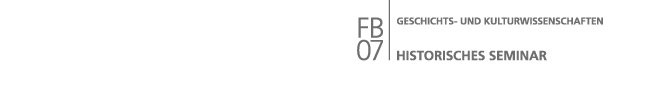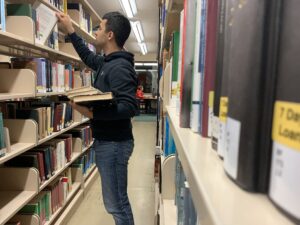Man bekommt einen Brief (in meinem Fall eine E-Mail), packt seine Koffer und darf dann in einem alten britischen Schloss studieren. Was sich hier nach dem Anfang einer Harry Potter ähnlichen Beschreibung anhört, wurde für mich im Wintersemester 2019/2020 und Sommersemester 2020 an der britischen Keele University Realität.
Durch meinen Einstieg über die Restplatzvergabe ins Erasmus-Programm beschränkte sich meine Anmelde- und Vorbereitungsphase auf ein Minimum - Auszug aus meiner Wohngemeinschaft, ein paar notwendige Formalitäten, die Beantragung eines Reisepasses (dieser wurde von der Universität trotz des Schengener Abkommens zusätzlich gefordert) sowie das Packen meiner Koffer.
Der Arbeitsbereich Global Opportunities der Keele University (vergleichbar mit der Abteilung Internationales an der JGU) nahm nach kurzer Zeit Kontakt zu mir auf und informierte mich u.a. über eine Facebook Gruppe zur formlosen Kommunikation und zum schnellen Austausch zwischen den Incoming-Students.
TIPP: Facebook ist in Großbritannien im Vergleich zu Deutschland eine deutlich wichtigere Kommunikationsplattform, ohne die man Gefahr läuft, weniger mitzubekommen. Arbeits- und Wohnheimgruppen, Societies sowie Clubs nutzen Facebook als Hauptkommunikationsplattform. Viele haben WhatsApp nutzen es allerdings wenig. Andere Messenger-Dienste spielten in meinem Umfeld keine Rolle. Wenn man keine entsprechende Flatrate besitzt, sollte man sich frühzeitig um eine britische SIM-Karte kümmern, um Kosten zu sparen. Darüber hinaus wird der Besitz einer britischen Telefonnummer unumgänglich, wenn man beispielsweise beim Friseur seine Telefonnummer in der elektronischen Kundenakte hinterlegen möchte oder die online Bestellfunktion eines Lieferdienstes nutzen will.
Der weitere Austausch mit der Abteilung Global Opportunities der Keele University beschränkte sich auf wenige Mails, die mich u.a. herzlich willkommen hießen, ggf. über nachzureichende Dokumente und das folgende Vorgehen informierten.
Der Austausch mit der Abteilung, aber auch allen Dozierenden war für mich überraschend formlos. Während an der JGU eine formale Kommunikation via E-Mail gefordert wird, wird man in Großbritannien mit Vornamen angeschrieben und duzt auch seine Dozierenden. Allgemein pflegt man einen sehr freundschaftlichen und ebenwürdigen Umgang.
Von Frankfurt intl. Airport über Manchester Airport nach Keele
Einige Wochen vor meinem Ryanair Flug von Frankfurt a.M. nach Manchester nahm eine kleine Gruppe britischer Studierender Kontakt zu mir auf, die unentgeltliche Busfahrten von umliegenden Flughäfen nach Keele organisierten. Dazu benötigten sie die Flugnummer, den Namen des Zielflughafens und die geplante Landezeit meines Flugs (Datum der Ankunft wurde frühzeitig vorgegeben).
TIPP: Vom Gedanken an eine emissionsärmere Reise mit der Bahn musste ich aus logistischen und finanziellen Gründen leider Abschied nehmen. Die Bahnfahrt wäre mit häufigem Umsteigen mit viel Gepäck, der Angst den Anschlusszug zu verpassen und sehr hohen Preisen verbunden gewesen. Um zusätzliche Kosten bei Ryanair zu sparen und die unterschiedlichsten Rabatte auch über den Auslandsaufenthalt hinaus nutzen zu können, lohnt sich evtl. der Erwerb einer Erasmus-Student-Network-Karte (siehe dazu: https://esncard.org). Diese ist beispielsweise an der Goethe Universität in Frankfurt a.M. erhältlich. Ich habe sie mir in England von der Leeds University per Post zuschicken lassen. Der Nutzen der Karte hängt von der individuellen Reiseplanung ab.
Am Flughafen in Manchester musste ich mich zunächst etwas durchfragen, um den Sammelpunkt des Abholteams zu finden, konnte diesen allerdings Dank gut informierter Sicherheitskräfte schnell finden. Anschließend gab es die Möglichkeit das Gepäck beaufsichtigt am Sammelpunkt abzustellen und während einer kurzen Wartezeit mit anderen Incoming-Students ins Gespräch zu kommen oder sich etwas zu essen zu kaufen.
An diesem Zeitpunkt hatte ich noch etwas Scheu mich auf Englisch mit anderen Studierenden zu unterhalten, was vor allem mit der irrationalen Angst nicht gut genug Englisch sprechen zu können bzw. peinliche Fehler zu machen zu begründen ist. Daher unterhielt ich mich zunächst nur mit einer deutschen Studentin, die ich durch meine Fachkoordinatorin im Fach Geschichte kennengelernt hatte. Diese informierte mich zuvor darüber, dass ich nicht der einzige Geschichtsstudierende sei, der nach Keele ginge, sodass wir uns bereits vor dem Auslandsaufenthalt einmal getroffen hatten, um uns gegenseitig die Angst vor dem bevorstehenden Abenteuer zu nehmen, indem wir unsere Fragen klärten und uns von unseren bisherigen Vorbereitungen erzählten.
Bezüglich der Angst Englisch zu sprechen, kann ich nur festhalten, dass sie absolut unbegründet war. Zum einen habe ich feststellen dürfen, dass es noch andere Studierende gab, deren englisch schlechter war als meines. Dies ist zwar nur ein schwacher Trost, jedoch hat es mir persönlich am Anfang geholfen dies zu bemerken. Zum anderen wurde man von den britischen Studierenden meist mit Komplimenten überhäuft, wie gut man ihre Muttersprache beherrsche, auch wenn dies aus subjektiver Sicht anders war. Es sorgte aber dafür, dass ich weniger Scheu hatte englisch zu sprechen und bereit war auch Fehler in Kauf zu nehmen. Im akademischen Kontext durfte ich ebenfalls immer wieder feststellen, dass viele Dozierende mich freundlich und ohne vorzuführen korrigierten bis ich mit der Zeit immer selbstsicherer wurde und sich ein Sprachgefühl entwickelte.
TIPP: Der verpflichtende Erasmus-eigene Online-Sprachtest findet an der Keele University keine Beachtung. Stattdessen gibt es in der ersten Woche (vor offiziellem Semesterbeginn) eine kurze Sprachprüfung, welche aus einer Hörverstehens- und einer Leseverstehensübung zusammengesetzt war, um zu prüfen, ob man einem Seminar oder einer Vorlesung tatsächlich inhaltlich folgen kann. Sollte man durchfallen besteht das Angebot einfachere Kurse zu belegen und einen zusätzlichen Englischkurs für internationale Studierende zu besuchen. Dieser ist auch freiwillig wählbar, ist aber dann durch einen anderen Kurs zu ersetzten. Ich hatte den Test zwar problemlos bestanden, wollte das Angebot jedoch trotzdem in Anspruch nehmen. Rückblickend hätte ich es nicht benötigt, sehe es aber auch nicht als Zeitverschwendung. Neben einem akademischen Wortschatz lernt man in dem Kurs den Aufbau eines Essays sowie Referate gemäß den universitätseigenen Vorstellungen. Wenn man dies nicht in Anspruch nehmen möchte, kann man auch Dozierende um die Erläuterung der lokalen Formalitäten bitten oder das fächerspezifische Handbuch auf dem Server der Universität KLE (vergleichbar mit LMS an der JGU) nutzen. Sollte man darüber hinaus noch Änderungen oder Fragen zu seiner Kurswahl haben, so findet kurz nach Ankunft in Keele eine verpflichtende Veranstaltung statt, bei der man solche Anliegen ansprechen kann.
Wohnen an der Keele University
Neben der Option sich privat eine Wohnmöglichkeit zu organisieren, bestand die Möglichkeit sich für die Wohnheime auf dem Campus der Universität zu bewerben. Erasmusstudierenden wird, anders als den britischen Studierenden unabhängig vom Fachsemester ein vorrangiges Recht auf Wohnheimzimmer eingeräumt. Dazu sei allerdings angemerkt, dass die Wohnheime auf dem Campus vergleichbar mit den Wohnheimen in Mainz deutlich teurer sind als private Zimmer. Die Vorteile eines Wohnheimzimmers bestehen vor allem darin, dass das gesamte Unileben auf dem Campus stattfindet, man sich die stressige Wohnungssuche spart, kurze Wege zu allen Veranstaltungen hat und direkt mit anderen Studierenden im Wohnheim in Kontakt kommt und so eine kleine Gemeinschaft bildet. Darüber hinaus ist die nächstgelegene Stadt (Newcastle under Lyme, nicht zu verwechseln mit der Partymetropole Newcastle upon tyne) einige Kilometer entfernt und da es kein Studiticket gibt, müssen Fahrtkosten zur Universität selbst getragen werden.
TIPP: Uber ist in Großbritannien deutlich günstiger, flächendeckender vertreten und allgemein attraktiver als in Deutschland. Kurzum ist es häufig die beste Wahl, wenn man nicht auf öffentliche Verkehrsmittel setzen kann oder will. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass eine Kreditkarte in Großbritannien von großem Nutzen ist. Sie ist nicht nur, als Zahlungsmittel für Verkehrsmittel üblich, sondern auch die kleine Bäckerei auf der Ecke akzeptiert Kreditkarten. Einige Dienstleistungen können nur mit Kreditkarte in Anspruch genommen werden. Barzahlungen sind eher die Ausnahme als die Regel.
Rundumfoto meines Wohnheim Zimmers mit eigenem Waschbecken im Wohnheim Lindsay Hall. Gemeinschaftstoiletten, -duschen und Küche befanden sich auf dem Flur.
Unterricht
Die Unterrichtsgestaltung in Keele unterscheidet sich in vielen Punkten von der JGU. Zum einen sind alle 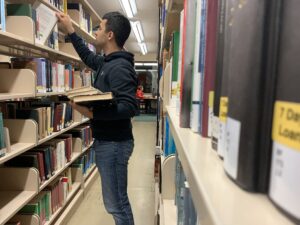 Unterrichtsformate (ausgenommen Vorlesungen) in deutlich kleineren Gruppen organisiert und man profitiert somit vor allem von der studentischen Fachdiskussion, die meist auf Grundlage von Hausaufgaben stattfand. Dies bedeutete folgerichtig auch einen zusätzlichen Vor- und Nachbereitsungsaufwand, der neben mehreren kleineren Abgaben während des Semesters eine ungewohnte Routine darstellte.
Unterrichtsformate (ausgenommen Vorlesungen) in deutlich kleineren Gruppen organisiert und man profitiert somit vor allem von der studentischen Fachdiskussion, die meist auf Grundlage von Hausaufgaben stattfand. Dies bedeutete folgerichtig auch einen zusätzlichen Vor- und Nachbereitsungsaufwand, der neben mehreren kleineren Abgaben während des Semesters eine ungewohnte Routine darstellte.
Diese Herausforderung wurde durch die Hilfsbereitschaft meiner internationalen und nationalen Kommiliton*innen erheblich erleichtert.
TIPP: Leider gibt es an der Keele University kein TextCafe, wie an der JGU. Sodass mir die sprachliche Kontrolle von befreundeten Muttersprachler*innen vor der Abgabe zusätzliche Sicherheit gab. Da alle Prüfungsleistungen anonym eingereicht werden, können und dürfen die Dozierenden Nicht-Muttersprachler*innen nicht gesondert benoten. Die Benotung von geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern wird im Bachelorstudiengang, anders als in Naturwissenschaften in Keele im besten Fall mit 75 von 100 Punkten benotet. Über 75 Punkte seien, so die Leiterin der Abteilung Global Opportunities, auch für nationale Studierende sehr unüblich, was Incoming-Students zunächst abschreckt, aber bei der Anrechnung in Deutschland berücksichtigt werden kann.
Zudem hatte die universitätseigene Bibliothek rund um die Uhr geöffnet und bot eine angenehme Arbeitsatmosphäre, die zu nächtlichen Lerneinheiten einlud und in meiner Freundesgruppe vor Ort wurden diese in der Prüfungsphase als gemeinsame Lerneinheiten zelebriert.
Die anfängliche Illusion in einem Schloss zu studieren muss ich an dieser Stelle leider zerstören. Unterrichte finden ausschließlich in moderneren Gebäuden auf dem Campus statt. Keele Hall (so heißt das Schloss auf dem Campus) ist ein Veranstaltungsort, der von Studierenden überwiegend für schöne Fotos genutzt wird. Allgemein besteht die Ortschaft Keele neben ein paar wenigen Wohnhäusern und einem Pub ausschließlich aus zur Universität gehörenden Gebäuden, Sportanlagen und Grünflächen.
Kulturelles und sportliches Angebot an der Universität
An der Keele University sind Societies und Clubs ein zentraler Bestandteil des sozialen Miteinanders und dieses sollte unbedingt wahrgenommen werden. Dafür gibt es für jede Interessegruppe entsprechende Gemeinschaften, die man zuvor online recherchieren oder alternativ auf einer Messe zum Beginn des  Wintersemesters kennenlernen kann (da alle nationalen Studierenden in Großbritannien zum Wintersemester anfangen, findet diese Messe nicht im Sommersemester statt). Gerade Sportclubs sind allerdings meist mit Kosten verbunden, die unterschiedlich hoch ausfallen können. Für internationale Studierende, die nur ein Semester in Keele bleiben, gibt es eine ermäßigte Gebühr.
Wintersemesters kennenlernen kann (da alle nationalen Studierenden in Großbritannien zum Wintersemester anfangen, findet diese Messe nicht im Sommersemester statt). Gerade Sportclubs sind allerdings meist mit Kosten verbunden, die unterschiedlich hoch ausfallen können. Für internationale Studierende, die nur ein Semester in Keele bleiben, gibt es eine ermäßigte Gebühr.
Der zentrale Vorteil an diesem Angebot ist die Aufnahme in eine soziale Interessensgemeinschaft an der Universität, die sich regelmäßig trifft und die Entstehung von langfristigen Freundschaften unterstützt. Diese Gemeinschaften sind vergleichbar mit jenen, die man aus amerikanischen Highschool Filmen kennt.
Ich wollte einen typisch britischen Sport ausprobieren und entschied mich daher für Rugby. Der Sport hatte mich so nachhaltig begeistert, dass ich nach meiner Heimkehr in Mainz in einen Rugby Club eintrat.
Außeruniversitäre Auslandserfahrung
Neben den Möglichkeiten, die mir an der Universität geboten wurden, war es mir ein Anliegen auch in Kontakt mit Menschen zu kommen, die in keinem direkten Kontakt mit der Universität standen. Da die britischen Studierenden in meinem Umfeld primär mit anderen Studiereden zu tun hatten, suchte ich durch Rugby diesen Zugang, der mir in der Retrospektive als hervorragende Entscheidung in Erinnerung blieb.
 Mit dem regionalen Rugby Verein in Newcastle under Lyme bereiste ich jeden Samstag England. Diese Spieltage wurden zu überregionalen Roadtrips mit interessanten Menschen, die mir vor allem die britische Kultur nochmal auf eine andere Weise näher brachten.
Mit dem regionalen Rugby Verein in Newcastle under Lyme bereiste ich jeden Samstag England. Diese Spieltage wurden zu überregionalen Roadtrips mit interessanten Menschen, die mir vor allem die britische Kultur nochmal auf eine andere Weise näher brachten.
Darüber hinaus besuchte ich mit meinem internationalen Freundeskreis unter anderem die Touristenhochburgen London und Edinburgh, für ein Konzert die Universität in Manchester, für einen Museumsbesuch Birmingham und zum Wandern den „Snowdonia National Park“ in Wales, der uns als Ausflugsziel ausdrücklich von einem Dozenten empfohlen wurde.
I n einem ergänzenden unbenoteten Seminar für internationale Studierende mit dem Titel „British Culture“ wurden uns von der sehr engagierten Dozentin auf humorvolle Weise Eigenheiten der britischen Gesellschaft nähergebracht. Ohne dem Inhalt etwas vorweg greifen zu wollen, kann ich die Belegung dieses freiwilligen Moduls nur wärmstens empfehlen (in meinem Beifach Philosophie konnte ich die Belegung für Studium Generale anrechnen lassen).
n einem ergänzenden unbenoteten Seminar für internationale Studierende mit dem Titel „British Culture“ wurden uns von der sehr engagierten Dozentin auf humorvolle Weise Eigenheiten der britischen Gesellschaft nähergebracht. Ohne dem Inhalt etwas vorweg greifen zu wollen, kann ich die Belegung dieses freiwilligen Moduls nur wärmstens empfehlen (in meinem Beifach Philosophie konnte ich die Belegung für Studium Generale anrechnen lassen).
Die Ankunft von Covid-19 in Keele und unserer Wahrnehmung
Das schnell mediendominierende Virus Covid-19 beeinflusste unseren Alltag zunächst eher schleppend. Da es sich bei der Keele University um eine eher kleine Universität mit fast schon familiärem Charakter handelte und alle Studierenden in Facebook-Gruppen organisiert waren, wurden wir erstmals durch die Diskussionen in diesen Gruppen auf die Ernsthaftigkeit des Virus aufmerksam. Während die meisten Studierenden schnell die Schließung der Universität zum Schutz Aller forderten, ließ die Reaktion der Universität auf sich warten. In den folgenden Tagen entschieden einige Dozierenden eigenmächtig ihre Veranstaltungen abzusagen, bis die Universität deren Handeln schließlich legitimierte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Abteilung Internationales der JGU bereits alle Studierenden darüber informiert, dass eine Rückkehr auf eigenen Wunsch keine Nachteile beinhaltet. Nachdem die deutschen Medien dann über Grenzschließungen im Süden Deutschlands berichteten, entschied ich nach Rücksprache mit meinen Eltern und Freunden den nächsten Flug zurück nach Deutschland zu nehmen. Zusammen mit zwei amerikanischen Studentinnen, die sich ebenfalls für die Heimkehr entschieden haben, brach ich um drei Uhr morgens zum Flughafen auf und informierte die JGU und meine Fachkoordinatorin über meine Entscheidung, die diese sehr verständnisvoll aufnahmen. Nach der Rückkehr nach Deutschland dauerte es anschließend noch zwei Tage bis die Universität in Keele alle Studierenden bat schnellstmöglich den Campus zu räumen. Darüber hinaus wurde das Lehrangebot unverzüglich digital und asynchron zur Verfügung gestellt und darauf hingewiesen, dass im Sinne der mentalen Gesundheit kein Zwang zu weiteren Abgaben und Prüfungen bestand. Auch im Folgenden bemühte sich die Universität um die mentale Gesundheit der Studierenden.
Rückblick: Ein Jahr nach der Rückkehr nach Deutschland
 Vermutlich dadurch, dass durch die Corona-Pandemie die Nutzung von Videokonferenzen in den Alltag Aller rückte, aber auch durch den allseitigen Wunsch nach weiterem Kontakt, finden noch heute regelmäßige Videokonferenzen zwischen meiner internationalen Freundesgruppe und mir statt. Langfristig sehe ich den Auslandsaufenthalt daher nicht nur als akademische Erfahrung, sondern auch als Möglichkeit zu sozialem länderübergreifendem Austausch, der zu anhaltenden Freundschaften führt.
Vermutlich dadurch, dass durch die Corona-Pandemie die Nutzung von Videokonferenzen in den Alltag Aller rückte, aber auch durch den allseitigen Wunsch nach weiterem Kontakt, finden noch heute regelmäßige Videokonferenzen zwischen meiner internationalen Freundesgruppe und mir statt. Langfristig sehe ich den Auslandsaufenthalt daher nicht nur als akademische Erfahrung, sondern auch als Möglichkeit zu sozialem länderübergreifendem Austausch, der zu anhaltenden Freundschaften führt.
Aus akademischer Sicht hat der Auslandsaufenthalt mir geholfen meine Art Hausarbeiten zu schreiben zu optimieren und mein Interesse für angelsächsische Geschichte geweckt, welches ich auch zukünftig weiter verfolgen möchte.
Verfasst von Richard Manuel Moreno