Öffentlicher Vortrag
Dr. Gunter Mahlerwein (Saarbrücken/Mainz):
Von Robin Hood und Rinaldo Rinaldini zu McCarthy und My Lai.
Wie spätmittelalterliche und frühneuzeitliche TV-Helden europäischen Kindern der 1950er bis 1970er Jahre die Welt erklärten
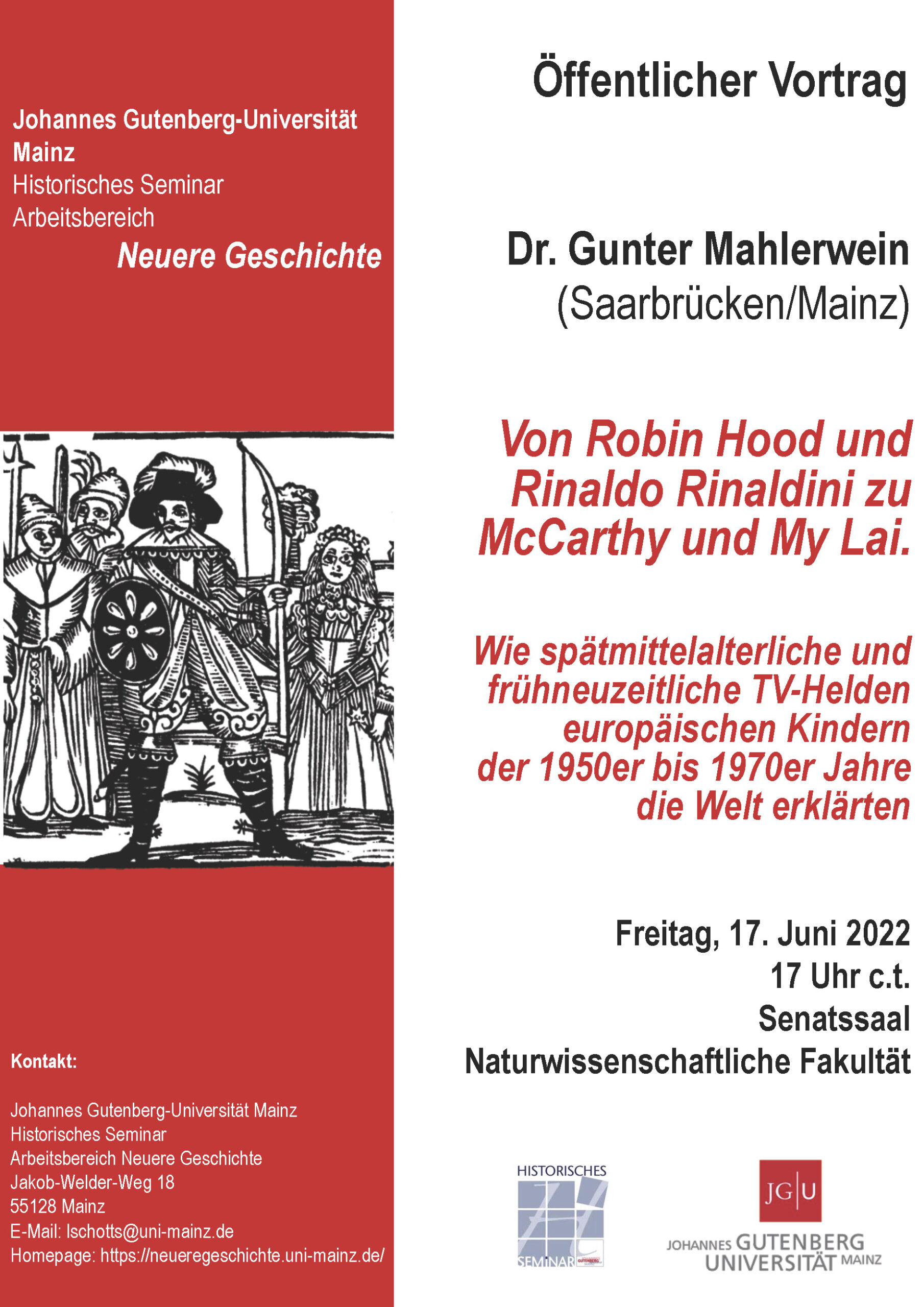
Dr. Gunter Mahlerwein (Saarbrücken/Mainz):
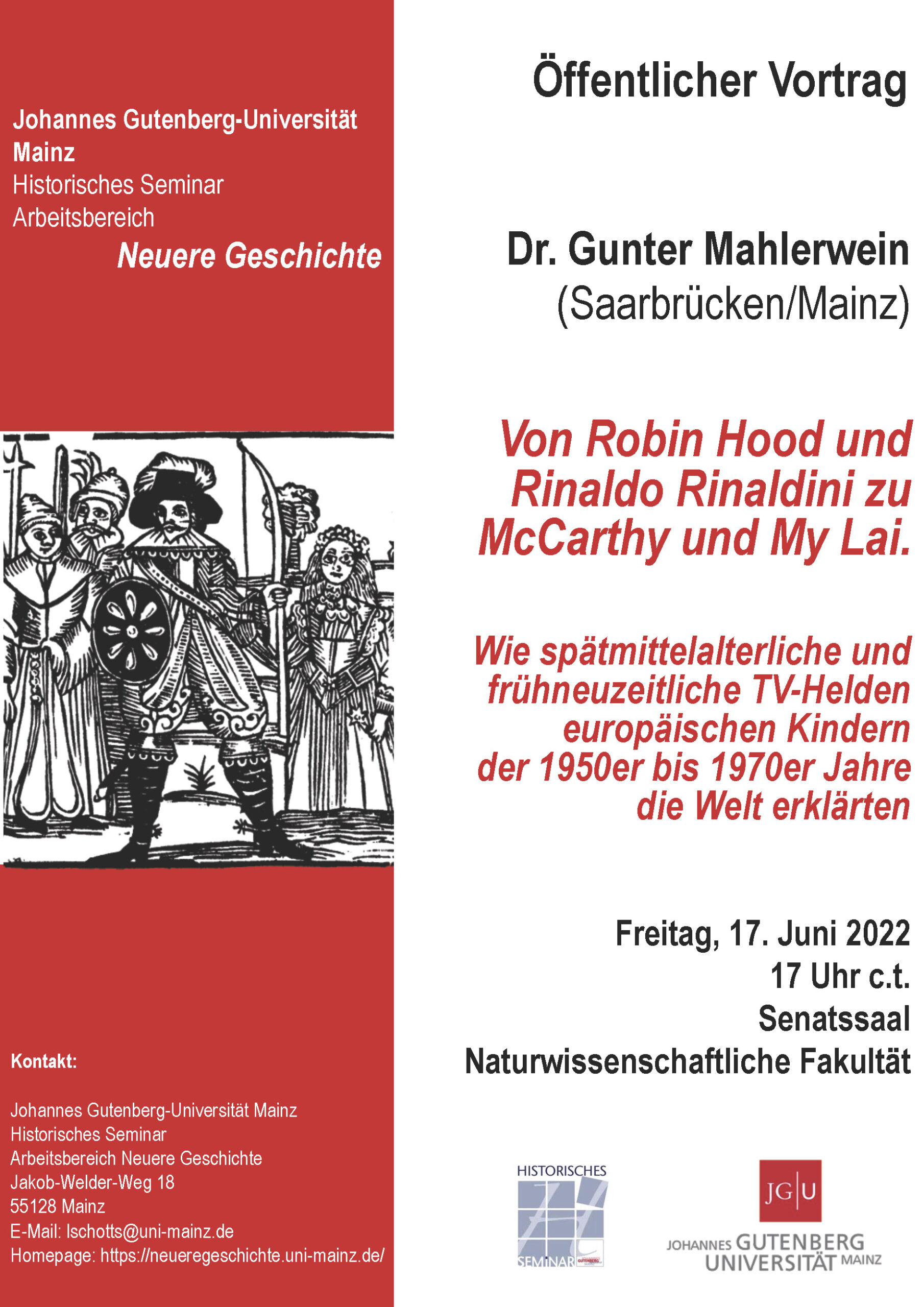
Der Krieg in der Ukraine, welcher am 24. Februar 2022 mit dem russischen Angriff begann, stellt den grausamen Kulminationspunkt einer Eskalation dar, welche spätestens seit der Krim-Annexion 2014 die Herrschaftsansprüche der Russischen Föderation in kriegerischer und völkerrechtswidriger Form vor Augen führt. Als vermeintliche Grundlage seiner Aggression gegenüber der Ukraine macht der Kreml, allen voran Putin, die angebliche Unterdrückung von Russen auf dem Gebiet der Ukraine, aber auch ein eigenes Geschichtsverständnis geltend, dessen Wurzeln weit in die Vergangenheit zurückreichen. Zugleich sollte der Ukrainekrieg der deutschen und anderen westlichen Gesellschaften zum Anlass dienen, eigene Fehleinschätzungen, Zerrbilder und Wissensdesiderate hinsichtlich kultureller, sprachlicher, politischer und wirtschaftlicher Umstände und ihrer Ursprünge nachhaltig zu korrigieren. Die hier angebotene Ringvorlesung soll einen Beitrag leisten, um aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven über diese Hintergründe aufzuklären und zu einer vertieften Beschäftigung mit Sachverhalten anzuregen, die sich auf ein bislang wenig bekanntes Terrain „direkt vor unserer Haustür“ beziehen.
Sommersemester, 18-20 Uhr
online unter: https://bbb.rlp.net/b/rad-ief-jn2-nse
Für Einzelheiten siehe: https://www.studgen.uni-mainz.de/ringvorlesung-ukraine/
oder hier den Flyer: Flyer RV Ukraine im Brennpunkt
Organisiert in Zusammenarbeit mit Björn Wiemer (ISTziB, JGU.)
Nekrologe und wo sie zu finden sind. Desiderate und Potentiale memorialer Überlieferung
Mittelalterliche Nekrologien erweisen sich als facettenreiche Quellengattung und sind anschlussfähig für viele Fragestellungen und Themenbereiche. Im Workshop, der am 13. und 14. Mai 2022 an der Johannes Gutenberg Universität Mainz stattfindet, soll der spezielle Blick auf ihre innere Typologie, ihre vielfältigen Funktionen und vor allem auch ihre Überlieferung in quantitativer wie qualitativer Hinsicht gerichtet werden. Trotz zahlreicher vorliegender Einzelfallstudien finden Nekrologien besonders im Vergleich mit anderen Quellengattungen nur wenig Beachtung und entbehren oft einer systematischen Herangehensweise. Der gemeinsame Zugriff im Rahmen des Workshops soll zu einem besseren Verständnis der Quellengattung beitragen.
Der Workshop findet am 13. & 14. Mai 2022 im Landesmuseum Mainz (Große Bleiche 49, 55116 Mainz) statt. Um Anmeldung bis zum 2. Mai 2022 wird gebeten.
Das Programm und weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://vergleichendelandesgeschichte.geschichte.uni-mainz.de/nekrologworkshop/
oder hier im Flyer: Flyer_Workshop_Nekrologe_2022
Mittelalterliche Nekrologien erweisen sich als facettenreiche Quellengattung und sind anschlussfähig für viele Fragestellungen und Themenbereiche Im Workshop soll der spezielle Blick auf ihre innere Typologie, ihre vielfältigen Funktionen und vor allem auch ihre Überlieferung in quantitativer wie qualitativer Hinsicht gerichtet werden. Trotz zahlreicher vorliegender Einzelfallstudien finden Nekrologien besonders im Vergleich mit anderen Quellengattungen nur wenig Beachtung und entbehren oft einer systematischen Herangehensweise. Der gemeinsame Zugriff im Rahmen des Workshops soll zu einem besseren Verständnis der Quellengattung beitragen.
Als Veranstaltungsort dient das Forum des Landesmuseums Mainz Das gesamte Gebäude ist barrierefrei. Zur Einhaltung des Hygienekonzeptes für den Workshop ist die Teilnehmerzahl begrenzt, um Anmeldung wird daher gebeten Der Einlass in die Tagungsräume unterliegt zudem der 3 G Regelung (Nachweis über vollständige Schutzimpfung, Genesenennachweis oder aktueller Testnachweis).
ACHTUNG: Der Workshop wurde verschoben und wird nun voraussichtlich im Frühjahr 2022 stattfinden!
Am Samstag 9. Oktober 2021 findet zum zweiten Mal der Tag der Landesgeschichte Rheinland-Pfalz statt.
Der Tag der Landesgeschichte versteht sich als Forum für alle, die sich für Landesgeschichte interessieren, und wird von der Kommission des Landtages für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz ausgerichtet.
In diesem Jahr findet der Tag in einem hybriden Format statt - sowohl vor Ort im Weiterbildungszentrum (WBZ) Ingelheim als auch digital.
Institutionen, Vereine und Initiativen präsentieren sich vor Ort wie auch im Netz und das diesjährige Schwerpunktthema „Mittelalter digital“ wird in vielfältiger Weise aufgegriffen, so etwa in Diskussionsrunden mit Chatbeteiligung, Kurzvorträgen oder im Rahmenprogramm. Außerdem bildet der 2. Tag der Landesgeschichte den Auftakt für das Landesjubiläum „75 Jahre Rheinland-Pfalz“.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bitten wir um Ihre Anmeldung zur Veranstaltung (vor Ort bzw. auch für eine digitale Beteiligung).
Die Veranstaltungshomepage mit dem Link zur Anmeldung erreichen Sie unter https://www.landtag.rlp.de/de/parlament/der-landtag-und-seine-aufgaben/kommission-fuer-die-geschichte-des-landes/tag-der-landesgeschichte/.
Auf dieser Seite erhalten Sie weitere Informationen wie z. B. das Veranstaltungsprogramm sowie am 9. Oktober auch den Livestream und Hinweise zum Minecraft-Wettbewerb „Leben im Mittelalter“, der an diesem Tag startet.
In Ingelheim selbst gibt es zusätzlich eine Reihe von Programmpunkten, die man nur analog vor Ort erleben kann.
Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch am Tag der Landesgeschichte!
Die Kommission des Landtages für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz
Zum Abschluss des Semesters veranstaltet das Hauptseminar „Geschichte der Sexualität im 19. und 20. Jahrhundert" (PD Dr. Markus Raasch) am 15.07.2021 um 11:00 Uhr eine 90minütige digitale Podiumsdiskussion mit dem Titel: Bodies: Between Legends and Medicine. Interpretations, Realities and Challenges of Sexuality.
Gemeinsam mit unseren Gästen, Prof. Dr. Johanna Bleker, Valentina Chiofalo, Tessa Ganserer MdL, Sarah Scheidmantel und Alli Sebastian Wolf, wollen wir uns verschiedenen Aspekten der Sexualität im Kontext der Medizin widmen. So sollen beispielsweise historische Kontinuitäten und Diskontinuitäten der Mythisierung von Narrativen um den menschlichen Körper, Transgeschlechtlichkeit und Intersexualität als auch das aktuelle Thema des Schwangerschaftsabbruchs diskutiert werden. Das Podium bringt medizingeschichtliche, politische, künstlerische, juristische, aktivistische und feministische Perspektiven zusammen. Das Podiumsgespräch wird auf englischer Sprache stattfinden.
Our panel, consisting of Prof. Dr. Johanna Bleker, Valentina Chiofalo, Tessa Ganserer, Sarah Scheidmantel and Alli Sebastian Wolf, will be looking to discuss different aspects of sexuality within the context of medicine. Topics such as historical continuities and discontinuities regarding the constructions of myths and legends surrounding the human body, transgender and intersexuality but also current topics such as abortion rights. Our panel combines historical, political, artistic, legal and feminist perspectives. The discussion will take place in English.
Am 13.&14. November 2020 findet die X. Nachwuchstagung der kgd (Konferenz für Geschichtsdidaktik) als virtuelle Konferenz an der JGU Mainz statt. Die seit 2001 regelmäßig alle zwei Jahre veranstalteten Nachwuchstagungen der KGD sind eine Institution der bundesweiten, disziplineigenen Nachwuchsförderung, die als Kommunikations-, Diskussions- und Präsentationsforum konzipiert ist. Sie bietet Nachwuchswissenschaftler*innen aus dem Bereich der Geschichtsdidaktik einen Rahmen, um ihre Qualifikationsarbeiten, aber auch andere Forschungsvorhaben einem interessierten und fachverbundenen Publikum vorzustellen. Die Beiträge und Poster der X. Nachwuchstagung der kgd spiegeln Schwerpunkte und Ansätze aktueller geschichtsdidaktischer Forschung und die vielschichtigen Forschungen des geschichtsdidaktischen Nachwuchses. Das umfasst Forschungen zu Theorie- und Lehr- bzw. Unterrichtskonzepten sowie zu Schüler*innenbeiträgen und -erzählungen im Geschichtsunterricht. Dabei werden sowohl der schulische Unterricht als auch verschiedene Stufen der Geschichtslehrerausbildung in den Blick genommen.
Die X. Nachwuchstagung der Konferenz für Geschichtsdidaktik findet als virtuelle Konferenz statt.
Alle weiteren Informationen finden Sie unter https://geschichtsdidaktik.uni-mainz.de/x-nachwuchstagung-kgd/.
10.06.2020
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) hat in der aktuellen Auswahlrunde der Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA ITN) im EU-Rahmenprogramm Horizont 2020 in einem hochkompetitiven Verfahren gemeinsam mit sieben weiteren europäischen Partnern ein Netzwerk zur Doktorandenausbildung eingeworben. In den nächsten vier Jahren werden elf Doktoranden mit einem außerordentlich attraktiven und innovativen Praktikumsanteil im nicht-akademischen Bereich ausgebildet.
Dabei steht "CARMEN" als Akronym für "Communal Art – Reconceptualising Metrical Epigraphy Network", in dem Historiker, Philologen und Archäologen gemeinsam an der Erforschung von Dichtung als Teil der Alltagskultur der Römer arbeiten werden. Im Zentrum stehen römische Inschriften in Versform, die Carmina Epigraphica. Diese stehen auf Grabsteinen und anderen Monumenten und sind beredte Zeugnisse der sozialen Beziehungen, der Sprachentwicklung, aber auch der ästhetischen Vorstellungen in Rom und den Provinzen. Mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und den Universitäten Trier, Dijon/Bourgogne, Sevilla, Wien, La Sapienza in Rom und der Universität des Baskenlandes sind hochkarätige Partner an dem Netzwerk beteiligt. Hinzu kommen eine Vielzahl weiterer Institutionen europaweit und im nördlichen Afrika, die sich aktiv in die Ausbildung der Doktorandinnen und Doktoranden einbringen. Prof. Dr. Marietta Horster, Althistorikerin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz seit 2010, wird das ITN koordinieren.
"Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat sich erneut in einem EU-Auswahlverfahren durchgesetzt und gemeinsam mit europäischen Partnern ein innovatives Netzwerk zur Doktorandenausbildung eingeworben. Als Wissenschafts- und Kulturminister freue ich mich ganz besonders darüber, dass auch die Generaldirektion Kulturelles Erbe und die Universität Trier Teil des Forschungsprojekts sind. Ich gratuliere herzlich", so Prof. Dr. Konrad Wolf, rheinland-pfälzischer Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.
Bunt und grau, rot und schwarz, liberal und repressiv: Im Rückblick erscheinen die 1970er Jahre als ein Jahrzehnt der Widersprüche. Arbeitskämpfe und Protestbewegungen gehörten zum politischen Alltag. Arbeiter*innen streikten für Lohnerhöhungen, Jugendliche verlangten Freiräume, Bürgerinitiativen forderten Mitbestimmung ein. Aufbruchsstimmung und Resignation machten auch vor der Opelstadt nicht halt. In Rüsselsheim, zu Beginn des Jahrzehnts dank Opel eine prosperierende Stadt, erlebten Planungseuphorie und Reformchancen vor dem Hintergrund der „Ölpreiskrise“ einen nachhaltigen Einbruch. Die historische Veranstaltungsreihe geht den Spuren der Konflikte und Krisen nach, die den gesellschaftlichen Umbruch in Rüsselsheim begleiteten.
Kontakt: anders@uni-mainz.de
6. Februar, 19 Uhr: Vortrag
„Diese Selbstverwaltung scheint tatsächlich zu funktionieren!!“ Die Jugendzentrumsbewegung der 1970er Jahre in Rüsselsheim und der Bundesrepublik
Dr. David Templin, Universität Osnabrück
23. April, 19 Uhr: Vortrag
„Wir glauben nicht, dass die Zukunft dem Mini gehören wird“. Opel zwischen Ölkrise und Strukturwandel
Flemming Falz, Universität Jena
5. Mai: Filmvorführung
Luft zum Atmen – 40 Jahre Opposition bei Opel in Bochum
Anschließend Gespräch mit der Regisseurin Johanna Schellhagen
13. Mai: Vortrag
„Wir bauen ein Gegenmanagement auf…“ Die Rüsselsheimer Opel-Belegschaft und ihre Interessenvertretung in den 1970er und -80er Jahren
Dr. Rainer Fattmann, Bonn
4. Juni: Vortrag
„Man muss den Kampf in der Fabrik in den weltweiten Kampf gegen das Kapital einordnen“. Konflikt und Protest im Rüsselsheim der 1970er Jahre
Dr. Freia Anders, JGU Mainz