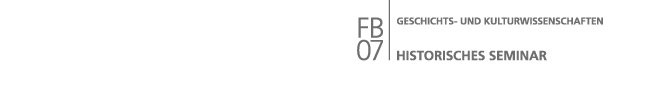Meine eiskalten Hände umklammern die Stäbe des Schaftransporters, während der Fahrer ungeachtet seiner menschlichen Fracht mit vollem Tempo durch die kurvenreichen Straßen Connemaras saust. Während ich zwischen Unglauben und Belustigung schwanke, denke ich, dass diese Erfahrung meinen Irland-Aufenthalt wohl am besten zusammenfasst: die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Iren, die Abenteuerlust und die Bereitschaft unkonventionelle Lösungen dankend anzunehmen. Wie ich in diese Situation gekommen bin? Dazu später mehr! Zunächst einmal zurück zum Anfang: zu der Entscheidung, ein Erasmus-Semester in Irland zu machen.
Organisation und Anreise
Zugegebenermaßen habe ich in meinem Studium über den cursus intégré viel Zeit im frankophonen Ausland verbracht. Und während Französisch immer meine Herzenssprache bleiben wird, so wollte ich mein Englisch nicht ganz vernachlässigen und vor allem meine „englische Persönlichkeit“ entdecken, um mich beim Sprechen wohler zu fühlen. Die Entscheidung, mich für ein Erasmus-Semester in Galway zu bewerben, habe ich sehr spontan und ohne viel Hoffnung getroffen – nur um mich dann umso mehr zu freuen, als ich überraschenderweise angenommen wurde. Die ganzen administrativen Schritte wurden zum Glück rechtzeitig von der JGU bzw. von der Partneruniversität kommuniziert und waren daher gut machbar. Die einzige wirkliche Schwierigkeit war die Wohnungssuche: Irland leidet unter einer gravierenden Wohnungskrise. Wer so wie ich einen (sehr teuren) Wohnheimsplatz in der Lotterie ergattert, hat daher das große Los gezogen.
Irland ist eine Insel, demnach ist es natürlich etwas schwieriger, aber umso lohnender so grün wie möglich anzureisen. Ich bin über London und Holyhead nach Dublin gefahren, eine sehr empfehlenswerte Strecke. Da ich mich bereits kurz nach der Abgabe meiner letzten Hausarbeit auf den Weg nach Irland gemacht habe, war es sehr hilfreich zwei Anreisetage zur mentalen Vorbereitung auf das Auslandssemester zu haben.
Die University of Galway / Ollscoil na Gaillimhe

Die Universität ist bei ausländischen Studierenden sehr beliebt – kein Wunder, bereits bei den Einführungsveranstaltungen wurden wir sehr herzlich willkommen geheißen. Folglich war es gar nicht so leicht einen der begrenzten Plätze in den Geschichtskursen zu bekommen. Ich habe mich daher auf Kurse aus den Celtic Studies konzentriert und habe sehr interessante archäologische, linguistische und historische Einblicke in keltische Kulturen bekommen. Ergänzt wurde der Ansatz durch einen Kurs in Irish Studies, wo wir über das Verständnis von place in der irischen Literatur gesprochen und insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen prächristlichen und christlichen Vorstellungen thematisiert haben. Ich konnte zudem einen Geschichtskurs über Globalisierung belegen und ein Seminar zur irischen Familiengeschichte. Ich würde immer empfehlen, so viele Irland-spezifische Kurse wie möglich zu belegen. Natürlich ist man zunächst einmal nicht auf dem gleichen Wissensstand wie die irischen Kommiliton*innen, dafür bekommt man aber ein gutes Gefühl dafür, welche Themen die Iren aktuell beschäftigen und welche Emotionen bei traumatischen historischen Ereignissen mitschwingen. Die Hungerskatastrophe von 1845-48 hat so für mich eine ganz andere Bedeutung gewonnen: lange Zeit habe ich sie als Katastrophe unter vielen betrachtet, in der irischen Geschichte stellt sie aber eine bedeutende Zäsur dar.
In fast allen Kursen hatte ich mid-term-Abgaben. Der Vorteil ist natürlich, dass man mehrere Noten bekommt und bei den finals auf dem Feedback der Professor*innen aufbauen kann. Die Abgaben sind zudem oft nicht besonders lang (1.000 bis 2.000 Wörter) und viele Professor*innen ermöglichen eine lange Bearbeitungszeit. Im Seminar fällt generell mehr Arbeit an, hier wurden zudem noch die mündliche Mitarbeit und eine Präsentation bewertet. Insgesamt sind die Professor*innen sehr hilfsbereit. Bei Nachfragen bezüglich Abgaben oder Klausuren wurde immer sehr schnell und ausführlich geantwortet und es ist wohl sogar möglich, einen Aufschub einer Abgabefrist zu beantragen, wenn zu viele Dinge auf einmal anstehen.
Doch die irische Universitätskultur besteht aus sehr viel mehr als den Kursen, insbesondere die zahlreichen Clubs und Societies führen zu einem sehr abwechslungsreichen Alltag.
Clubs & Societies
Mit 125 aktiven Societies bietet die University of Galway ein sehr breites Angebot der Freizeitgestaltung. Neben fächerbezogenen Societies (denen aber jeder unabhängig vom Studiengang beitreten kann) gibt es beispielsweise eine Taylor Swift-, eine Amnesty-International-, eine Dance- und eine Granny-Society. Die Societies werden von Studierenden initiiert und geführt und sind daher mal mehr, mal weniger aktiv. Die History Society (Cumann Staire) hat beispielsweise einen Vortrag angeboten und sich ansonsten hauptsächlich auf social nights (sprich: Barabende) konzentriert. Die Dance-Society hatte dagegen verschiedene Kursprogramme erstellt, die man während des Semesters ausprobieren konnte. Beim Society Day stellen sich viele Societies vor und man kann direkt beitreten oder sich per E-Mail über Veranstaltungen informieren. Das ist zunächst einmal keine Verpflichtung zu irgendetwas, es ist daher empfehlenswert verschiedenen Societies beizutreten und dann zu schauen, wie aktiv man sich beteiligen möchte. Abgesehen von den Kursen der Dance-Society sind die meisten Gruppen auch kostenlos. Insgesamt habe ich die Societies als tolle Gelegenheit wahrgenommen, andere Studierende kennenzulernen – man teilt ja zumindest ein Interesse. Meine einzige Enttäuschung war Cumann Gaelach, die irische Society, der ich voller Motivation mich so gut wie möglich zu integrieren, beigetreten bin. Da aber sämtliche Kommunikation nur auf Irisch stattfand und sich meine Irisch-Kenntnisse auf einige wenige Wörter beschränken, habe ich leider nie herausgefunden, wann die Treffen stattfinden sollten. Gerade wer sich für Traditionen anderer Kulturen interessiert, kann die Augen bezüglich der Angebote der Indian Society, Mexican Society und Indonesia Society (um nur einige Beispiele zu nennen) offenhalten. An bestimmten Fest- und Feiertagen finden größere Aktionen statt, an denen auch Interessierte aus anderen Ländern willkommen sind.

Auch das Sportangebot der Universität ist sehr breit gefächert. Verschiedene Clubs bieten mehr oder weniger leistungssportorientierte Sportarten an. So konnte ich Windsurfen ausprobieren und an einigen wunderbaren Wanderungen des Mountaineering Clubs teilnehmen. Gerade die Wander-Gruppe ist hervorragend organisiert. Jeden Sonntag (außer bei Sturmwarnung) wird ein Bus gemietet, um in die Connemara zu fahren, wo die ganze Truppe im weglosen Terrain einen Berg hochstapft. Natürlich muss man sich auf die irischen Wetterverhältnisse einstellen: nicht selten haben wir den ganzen Tag hauptsächlich Wolken gesehen, sind im Regen und bei heftigem Wind mit unserem Mittagessen in der Hand durch das Moor gestapft bzw. gerannt und haben unsere Vorstellungen von Spaß ernsthaft hinterfragt. An anderen Tagen hat uns die Novembersonne positiv überrascht und die atemberaubende Aussicht höchst beeindruckt. In der Regel starten zwei bis drei Gruppen mit unterschiedlichem Geschwindigkeits- und Schwierigkeitsgrad. Bei einem Torture hike mussten wir aufgrund einer leicht verletzten Teilnehmerin etwas früher absteigen und fanden uns in einem kleinen Dorf wieder. Die Bewohner hatten volles Verständnis dafür, dass wir die anderen Gruppen noch im Stamm-Pub des Mountaineering Clubs treffen wollten und um uns fünf weitere Kilometer auf der Straße zu ersparen, luden sie uns kurzerhand in ihren Schafttransporter ein. So klammerten wir uns an den Wänden fest und flitzten in Höchstgeschwindigkeit zum Pub – definitiv eine besondere Erfahrung, die daher als Einstieg für diesen Beitrag herhalten musste.

Coldvember
Nicht nur bei den Wanderungen wagen sich die Iren in das eher ungemütliche Wetter, im November wird der Witterung höchst motiviert getrotzt und gefühlt die halbe Universität trifft sich bei Sonnenaufgang zum Schwimmen. Ich bin zugegebenermaßen nur einmal die Woche in das doch sehr kalte Wasser gesprungen, doch es war definitiv sehr lohnenswert! Einmal hat es sogar geschneit, nachdem ich es barfuß über den Schnee geschafft hatte, hat sich das ca. 8-Grad kalte Wasser beinahe warm angefühlt. Auch der Coldvember passt für mich zur irischen Mentalität: man kann aus allem eine Party machen und von ein bisschen schlechtem Wetter lässt man sich ganz bestimmt nicht aufhalten!

Musik und Tanz
Galway scheint aus Musik zu bestehen: in den Straßen und in den Pubs wird ständig Live-Musik gespielt. Wer sich für traditionelle Musik interessiert, ist hier natürlich am richtigen Ort. Ich bin zugegebenermaßen keine große Bier-Trinkerin und dachte daher, dass ich die Pubs eher meiden würde. Tatsächlich habe ich einen nicht unbedeutenden Teil meiner Freizeit in Cafés, Teehäusern und Pubs verbracht, weil hier ein Großteil des Soziallebens stattfindet. Pubs fühlen sich häufig an wie große Wohnzimmer, in denen man abends zusammenkommt, um sich auszutauschen, Musik zu hören und zu tanzen. Es wird oft nicht als unhöflich betrachtet nichts zu trinken. Einer meiner Lieblingspubs ist der Crane, ab 21h30 wird dort Trad Music gespielt. Insbesondere samstags platzt der kleine Raum aus allen Nähten, gerade dann sind tolle Musiker vor Ort. Auch wenn die Musiker natürlich im Zentrum stehen, darf nahezu jeder spontan singen und tanzen, wodurch es ein gemeinsames Musikerlebnis wird. Einer meiner schönsten Irland-Momente ist mit diesem Pub verknüpft: Ich habe in Galway sowohl an der Universität (über die Dance Society) als auch in der Stadt (über den Céili-Club) Céili-Tanzstunden genommen. Es handelt sich um Set dances, die in der Regel mit acht Personen getanzt werden. Die meisten Bekanntschaften habe ich insbesondere über den Céili-Club geschlossen, eine sympathische Gruppe mit unglaublich liebenswerten Tanzlehrern. Nach dem Kurs wird montags immer im Thirteen on the Green getanzt, zudem treffen sich einige der erfahrenen Tänzer*innen immer donnerstags ab 21h30 im Monroes. Wer sich die Tänzer also lieber nur von außen anschauen möchte, ist dort am richtigen Ort. Einmal wurden wir im Crane aufgefordert zu tanzen, was ein unglaubliches Erlebnis war, zumal ich bei jedem weiteren Besuch von den Musikern erkannt und gefragt wurde, ob ich wieder tanzen würde. In der Musikszene von Galway als Céili-Tänzerin bekannt zu sein, hat mich definitiv sehr stolz gemacht, auch wenn ich natürlich weit davon entfernt bin, all die Tänze sicher zu beherrschen.


Ausflüge und Reisen
Ich kann mich generell nur schwer an einem Ort wohlfühlen, wenn ich kein Fahrrad zur Verfügung habe, daher habe ich an meinem ersten Tag in Galway sofort ein günstiges Rad gekauft. Wirklich Radwege gibt es leider nicht und auch an den Linksverkehr musste ich mich erst gewöhnen, doch bei dem unzuverlässigen öffentlichen Verkehr war es definitiv eine richtige Entscheidung. Manche Erasmus-Studierenden haben mir erzählt, dass sie in der gesamten Zeit nur drei oder vier Mal am Meer waren, dank meines Fahrrads konnte ich drei bis vier Mal in der Woche am Meer vorbeifahren.

Im Vergleich zu meinen anderen Auslandsaufenthalten bin ich relativ wenig durch das Land gereist – in Galway und durch die Ausflüge des Mountaineering-Clubs gab es genug zu erleben und zu sehen. Ein paar Ausflüge sind dennoch erwähnenswert.
Ich bin mit der Fähre in Dublin angekommen, daher konnte ich mir die Stadt etwas ansehen. Gerade die Museen (insbesondere das Archäologie-Museum und die Burg) sind sehr empfehlenswert. Wenn man kein Auto zur Verfügung hat, können von Galway aus geführte Touren zu den Cliffs of Moher und zur Kylemore Abbey gebucht werden. Zudem kann man mit Bus und Fähre zu einer der drei Aran-Islands fahren. Ich selbst war nur auf den beiden kleineren (Inishmaan und Inisheer), beide Ausflüge haben mir sehr gut gefallen.

Mit meiner Familie, die mich im Herbst besucht hat, habe ich einen kleinen Roadtrip zur Dingle-Halbinsel, nach Cashel und Glendalough gemacht, eine Reise, die ich wärmstens empfehlen kann. Die Dingle-Halbinsel bietet atemberaubende Landschaften und interessante historische Stätten wie das Gallarus-Oratorium, eine hohe Dichte an Ogam-Stones (Inschriften in einem an primitive Irish angepassten Schriftsystem) sowie prähistorische Siedlungen. Glendalough zeugt von der bedeutenden monastischen Kultur des mittelalterlichen Irlands, gelegen in den Wicklow-Mountains lädt der Ort zu Wanderungen ein.


Auch Belfast ist relativ gut zu erreichen. Mit dem Zug über Dublin kommt man schnell nach Nordirland, von dort aus kann man geführte Bustouren an der Küste entlang zum beeindruckenden Giant's Causeway buchen. Da viele Orte Schauplätze für Games of Thrones waren, hat unser Tourguide sogar Kostüme zum Verkleiden mitgebracht – eine kleine Sünde für eine Geschichtsstudentin, sich kostümiert in einer mittelalterlichen Burg ablichten zu lassen, zugleich natürlich eine lustige Erfahrung.

Der Abschied
„Diese Abschiede auf irischen Bahnhöfen, an Bushaltestellen mitten im Moor, wenn die Tränen sich mit Regentropfen mischen und der atlantische Wind weht…“, so schreibt Heinrich Böll im Irischen Tagebuch. Natürlich hinkt der Vergleich: Böll thematisiert die irische Emigration in den 1950er Jahren und ich stand auch nicht an einer Bushaltestelle im irischen Moor. Doch zugleich konnte ich mich mit seiner Schwermut und dem Abschiedsschmerz identifizieren. Ich hatte mich auf Galway gefreut, doch ich war davon ausgegangen in den vier Monaten lediglich oberflächliche Bekanntschaften zu schließen und nur kleine Einblicke in die irische Kultur zu bekommen. Ich hätte es besser wissen müssen: schon nach wenigen Wochen war Galway mein Zuhause geworden und ich habe mich unglaublich wohl gefühlt. Und wenngleich es kein Abschied für immer sein muss, so war mir doch klar, dass dieses erlebnisreiche und beinahe magische Erasmus-Semester nun vorbei war. Dass spontan meine Fähre gecancelt wurde und meine mühsam geplante Zugreise buchstäblich ins Wasser fiel, machte den Aufbruch auch nicht viel leichter.

Ich bin unglaublich dankbar für dieses Erasmus-Semester. Ich habe viel gelernt, meine englischsprachige Persönlichkeit weiterentwickelt und vor allem ein kulturell und landschaftlich unglaublich reiches Land kennen und lieben gelernt.