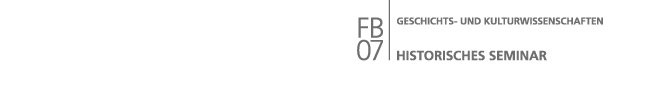Unglaublich, aber wahr: auch mein Auslandsaufenthalt an der Université de Sherbrooke in Kanada ist mittlerweile vorbei. Ich blicke auf 8 spannende Monate zurück, die sowohl meiner fachlichen, als auch meiner persönlichen Entwicklung zuträglich waren.
Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, unter anderem, weil sie mich wieder in Einklang mit meiner Studienwahl gebracht hat, nach einer Periode, in der ich mir nicht mehr sicher war, ob meine Entscheidung Geschichte und Französisch zu studieren, richtig gewesen ist.
Diese Frage habe ich mir vor allem in Dijon gestellt, denn für eine gewisse Zeit hatte ich dort den Spaß an meinen Fächern verloren. Da kam der Wechsel nach Sherbrooke wirklich zum rechten Zeitpunkt. Und glücklicherweise habe ich die Freude am Studium bereits zu Beginn wiedergefunden. Ich denke, dass dies mit der Vielfalt der Aufgabenstellungen und der Themen zusammenhängt.
Als Studentin an der Université de Sherbrooke fühlte ich mich gut aufgehoben und ernst genommen. Ich habe die sehr persönliche Betreuung, die durch die kleinen Seminargruppen möglich war, sehr genossen und als Luxus wahrgenommen. Allerdings muss man natürlich im Kopf haben, dass dieser Luxus auch durch die hohen (verglichen mit Deutschland und Frankreich) Studiengebühren erst möglich wird.
Einheimische, das heißt Quebecer Studierende zahlen etwa 500 Kanadische Dollar pro Kurs, pro Trimester. Um als Vollzeitstudierender zu gelten, muss man mindestens 4 Kurse pro Trimester belegen. Viele Studierende müssen neben dem Studium arbeiten, nehmen Studienkredite auf und starten somit hochverschuldet in ihr Arbeitsleben. Chancengleichheit sieht anders aus. Ich glaube, unter diesen Bedingungen ist es sehr mutig, wirklich das zu studieren, was einen interessiert und seine Studienwahl nicht von ökonomischen Aspekten abhängig zu machen.
Um das eigene Unisystem zu Hause zu verbessern oder um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was man an der Heimatuniversität schätzen sollte, sind Auslandsaufenthalte perfekt geeignet. Es geht nicht darum, festzustellen, welches System das Beste ist, sondern zu verstehen, dass Lernphilosphien und Methoden von Land zu Land variieren und dass man sich das Ein oder Andere vielleicht abgucken kann, oder aber auch Modell sein kann.
Ich glaube, in Deutschland wird viel Wert auf Eigenständigkeit und kritischen Geist gelegt. In den Kursen wird einem für die eigentliche Hausarbeit inhaltlich weniger Input gegeben, als es vielleicht in Kanada der Fall ist. In Frankreich scheint die Form oft über den Inhalt zu stehen. Die Forderung nach strikter Einhaltung der klassischen Form einer französischen Dissertation, habe ich in Dijon oft als geistigen Käfig empfunden, da die Formvorgaben den Inhalt zu determinieren scheinen.
Allerdings hat mir diese Vorgehensweise in Sherbrooke ungemein bei der Strukturierung meiner Klausuren und meiner Hausarbeiten geholfen. Dieser positive Effekt konnte sich meiner Meinung nach nur einstellen, weil es nicht von „oben“ erwartet, erzwungen war und so kam es, dass ich unter meiner ersten Geschichtsklausur den Vermerk fand: „Exzellente Dissertation“.
Das heißt, ich habe gelernt, dass ich mit Freude und auch mit Erfolg studiere, wenn ich verstehe, welche Methode oder welche Herangehensweise am besten zu mir passt. (Mehr oder weniger) unabhängig vom System, das mich umgibt, kann ich mir so meinen persönlichen Freiraum schaffen, in dem ich gut arbeiten kann: oder kurzum gesagt, beherzigen, was zu meiner Arbeitsweise passt, getrost bei Seite lassen, was nicht zum Gelingen meiner Aufgabenstellung beiträgt.
Das Studium ist eine Sammelsurium an Angeboten und Methoden, von denen man eben erst herausfinden muss, welche am geeignetsten für einen selbst sind: Auslandsaufenthalte sind hierbei mehr als hilfreich 🙂
PS: Die folgenden Bilder sind während meiner Kanada-Duchquerung (von der Atlantikküste in Halifax bis an die Pazifikküste in Vancouver) entstanden. Eine Reise, die ich nach Abschluss meines Studiums an der Université de Sherbrooke unternommen habe.