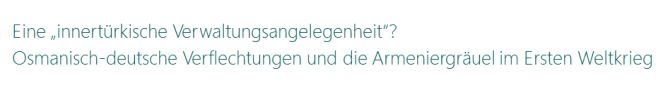Armeniergräuel in der deutschen Gegenwart

Trotz des Bildungsauftrags der Bundestagsresolution von 2005 hat die deutsch-osmanische Verflechtungsgeschichte der Armeniergräuel bisher kaum einen Weg in die historisch interessierte Öffentlichkeit gefunden. Es gibt jedoch Momente, an denen die latenten Spannungen aus diesem Themenfeld spürbar werden. Am 21. März 2014 wurde etwa Edgar Hilsenraths Roman „Das Märchen vom letzten Gedanken“ in Konstanz als Theaterstück uraufgeführt. Aus der Sicht eines Meddahs (Märchenerzähler) wird in dem Roman dem Armenier Thovma Khatisian kurz vor seinem Tod die Geschichte seines Vaters, der die Gräuel an den Armeniern aus dem Jahre 1915 miterlebte, geschildert. Das Bild hier zeigt Proteste gegen die Uraufführung des Theaterstücks. Neben den Faschismus-, Rassismus- und Volksverhetzungsvorwürfen fallen hier besonders zwei Plakate ins Auge: „Überlasst den Historikern die Geschichte“ und „Das ist ein Problem zwischen der Türkei und Armenien. Warum mischt sich Deutschland ein?“ steht auf ihnen.
Auf die zweite Frage sind wir in dieser Ausstellung eingegangen: Schon durch die Verflechtungen des Deutschen Reiches in die Armeniergräuel kommt Deutschland heute eine besondere Rolle in der Verbesserung der Beziehungen zwischen Türken und Armeniern zu. Die erste Frage ist schon anspruchsvoller: Ist es legitim, diese Geschichte Historiker/innen zu überlassen? Vielleicht auch, damit sie erst einmal Vorarbeiten leisten? Tatsächlich haben Historiker in den letzten Jahren sehr intensiv an der historischen Rekonstruktion gearbeitet. Die öffentliche Auseinandersetzung steht noch aus. Die aktive Auseinandersetzung mit Gewalt, Vertreibung und Massakern darf Historikern aber sicher nicht alleine überlassen werden. Diese Posterausstellung soll die Diskussion der osmanisch-deutschen Verflechtungen und der Armenier-Gräuel im Ersten Weltkrieg vorantreiben. So kann jeder Einzelne „dabei mithelfen, dass zwischen Türken und Armeniern ein Ausgleich durch Aufarbeitung, Versöhnen und Verzeihen historischer Schuld erreicht wird“, wie es der Bundestag 2005 gefordert hat.
"Sie werden das große Massaker Völkermord nennen oder Massenmord, und die Gelehrten unter ihnen werden sagen, es heiße Genozid."

Die größte Emotionalisierung in der Auseinandersetzung mit diesem Thema bewirkt ein Begriff, den wir bis hierher vermieden haben; die Frage nämlich, ob die Ereignisse von 1915 und 1916 ein Völkermord waren. Seit Langem fordert Armenien von der Türkei, den Tatbestand des Völkermordes anzuerkennen; in Foren und Netzwerken werden Staaten gezählt, die diesen Schritt bereits gegangen sind. Genauso beharrlich weist die Republik Türkei den Völkermordvorwurf seit Langem zurück. Die Bundestagsresolution von 2005 vermeidet den Begriff, benennt aber alle definitorischen Elemente von Völkermord aus der einschlägigen UN-Konvention von 1948 als gegeben.
Legt man diese Definition zugrunde, dann handelt es sich bei den geschilderten Ereignissen – das ist in der historischen Forschung auch nicht mehr umstritten – selbstverständlich um einen Völkermord. Das erklärt jedoch zu wenig; wir haben daher den zeitgenössischen Begriff der Armeniergräuel genutzt, um die Versuche der Zeitgenossen, ihre eigene Fassungslosigkeit in Sprache zu übersetzen, nachzuvollziehen.
Am Ende sind es nicht die Worte, die entscheiden sollten, sondern die Verständigung in der Sache – und die Erinnerung an die Opfer. Das entspricht auch dem Plädoyer in Edgar Hilsenraths "Märchen vom letzten Gedanken", in dem der Meddah erklärt:
"Egal, was da auf uns losstürzt: die Historiker werden sich ins Fäustchen lachen, besonders die Zuständigen für zeitgenössische Geschichte (…). In ihrer Phantasielosigkeit werden sie nach Zahlen suchen, um die Massen der Erschlagenen einzugrenzen - sie sozusagen: zu erfassen -, und sie werden nach Wörtern suchen, um das große Massaker zu bezeichnen und es pedantisch einzuordnen. Sie wissen nicht, daß jeder Mensch einmalig ist, und daß auch der Dorftrottel im Heimatdorf deines Vaters das Recht auf einen Namen hat."
Autoren: David Selzer, Andreas Frings
Material
Quelle 1: Yann Martel
In dieser Hinsicht ist die deutsche Übersetzung von Yann Martels "Beatrice and Virgil" (Ein Hemd des 20. Jahrhunderts; Frankfurt/Main 2010) sehr aufschlussreich. Yann Martel thematisiert dort die Erzählbarkeit der großen Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts. In einer Szene diskutieren Beatrice (ein Esel) und Vergil (ein Affe), welchen Namen sie dem durchlebten Schrecken geben können:
BEATRICE: Wie sollen wir es nennen?
VERGIL: Das ist eine gute Frage.
BEATRICE: Die Vorfälle?
VERGIL: Nicht deutlich genug. Und es steckt auch kein Urteil darin. Der Name muss das Wesen ausdrücken.
BEATRICE: Das Undenkbare? Das Unvorstellbare?
VERGIL: Was sollen wir uns dann überhaupt damit abgeben, wenn es undenkbar oder unvorstellbar ist?
BEATRICE: Das Unbenennbare?
VERGIL: Wenn wir es nicht einmal benennen können, wie können wir dann darüber reden?
ВEАTRIСE: Die Sintflut?
VERGIL: Mit dem Wetter hatte das nichts zu tun.
BEATRICE: Die Katastrophe?
VERGIL: Das könnte alles sein, Flut, Erdbeben, ein Grubenunglück.
ВEАTRIСE: Die Feuersbrunst?
VERGIL: Klingt wie ein Waldbrand.
ВEАTRIСE: Der Schrecken?
VERGIL: Zu punktuell - etwas, wo man rennt und außer Atem kommt. Das Planmäßige kommt nicht darin zum Ausdruck. Außerdem ist es schon belegt.
ВEАTRIСE: Das Tohuwabohu?
VERGIL: Klingt wie ein kalorienarmer Nachtisch.
BEATRICE: Das Grauen?
VERGIL: Schon besser.
BEATRICE: Gräuel, das ist noch besser. Die Gräuel. Mehrzahl. Gräuel, das klingt wie ein Schöpflöffel, der eine Suppe aus der Hölle löffelt, der das Undenkbare und das Unvorstellbare aufkellt, die Katastrophe, die Feuersbrunst, den Schrecken und das Tohuwabohu.
VERGIL: Dann wollen wir es die Gräuel nennen.
BEATRICE: Gut.
(Pause.)
BEATRICE: Und wie reden wir nun über die Gräuel?
Diese Passage lässt sich sicher als Ausgangspunkt für eine weitere Diskussion über die verwendeten Begrifflichkeiten nutzen. Denkbar ist auch Quelle 2: ein Auszug aus Edgar Hilsenraths Märchen vom letzten Gedanken:
Quelle 2: Edgar Hilsenrath
»Das große Massaker!« sagte der Märchenerzähler. »Jeder in diesem Land wußte, daß es kommen würde, aber nur wenige konnten sich wirklich etwas Konkretes darunter vorstellen. Was hatten die Türken mit den Armeniern vor? Würden sie alle abschlachten, so wie man Schafe abschlachtet? Und das vor den Augen der zivilisierten Welt? Wer würde den Armeniern helfen? Etwa Kaiser Wilhelm der Zweite, der Angst hatte, auch nur das Geringste zu tun, was die verbündeten Türken verärgern könnte? Oder Kaiser Franz Joseph, der alt war und Schwierigkeiten beim Pinkeln hatte? Konnten die Russen helfen oder die Engländer oder die Franzosen? Waren sie nicht viel zu weit weg vom Geschehen ... auf der anderen Seite der Front? Oder würde es nur beim Aufschrei der Weltpresse bleiben, um dann weggespült zu werden mit dem Müll alter Zeitungen? - Aber glaube mir, mein Lämmchen. Egal, was da auf uns losstürzt: die Historiker werden sich ins Fäustchen lachen, besonders die Zuständigen für zeitgenössische Geschichte, denn sie brauchen zur Unterbrechung ihrer Langeweile neuen Stoff, einen Stoff, mit dem sich arbeiten läßt. In ihrer Phantasielosigkeit werden sie nach Zahlen suchen, um die Massen der Erschlagenen einzugrenzen - sie sozusagen: zu erfassen -, und sie werden nach Wörtern suchen, um das große Massaker zu bezeichnen und es pedantisch einzuordnen. Sie wissen nicht, daß jeder Mensch einmalig ist, und daß auch der Dorftrottel im Heimatdorf deines Vaters das Recht auf einen Namen hat. Sie werden das große Massaker Völkermord nennen oder Massenmord, und die Gelehrten unter ihnen werden sagen, es heiße Genozid. Irgendein Klugscheißer wird sagen, es heiße Armenozid, und der allerletzte Fachidiot wird in Wörterbüchern nachschlagen und schließlich behaupten, es heiße Holocaust.«
Edgar Hilsenrath: Das Märchen vom letzten Gedanken. München 1989, S. 174.