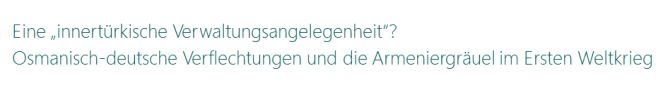Die „Armeniergräuel“ im Ersten Weltkrieg werden in den bundesdeutschen Geschichtslehrplänen außer Acht gelassen. Dennoch lassen sich einige Anknüpfungsmöglichkeiten zum Thema finden:
Anknüpfend an den rheinland-pfälzischen Geschichtslehrplan bietet sich das Thema in der 9. Klasse (Realschule, Gymnasium) bei der Behandlung des Ersten Weltkrieges an. So kann anstelle der Westfront am Beispiel „Verdun – Schauplatz der Unmenschlichkeit“ (Lehrplan, Sek. I, S. 231) die Perspektive gewechselt und das Osmanische Reich als Schauplatz im Ersten Weltkrieges problematisiert werden. Am Beispiel der Armeniergräuel lassen sich die osmanisch-deutschen Verflechtungen im Ersten Weltkrieg darstellen sowie die Handlungslogiken und Motive deutscher und osmanischer Akteure analysieren. Dabei können zahlreiche Diskussionsfragen aufgeworfen werden, die z.B. die deutsche Mitverantwortung thematisieren oder das bürgerliche Desinteresse am Osmanischen Reich (Einstiegsmöglichkeit: Goethe, Faust I, Osterspaziergang) problematisieren. Hieran können einige Gegenwartsbezüge zu aktuellen außenpolitischen Ereignissen und dem Interesse/Desinteresse daran in der deutschen Öffentlichkeit hergestellt werden.
Auch der Umgang, die Deutungsbemühungen und die Rezeptionen der Armeniergräuel nach 1918 sowie in der Gegenwart (Bundestagresolution von 2005) können im Unterricht (auch fächerübergreifend mit Sozialkunde) problematisiert werden. Die umstrittenen Fotografien von Armin T. Wegner zu den Armeniergräueln würden sich auch als Beispiel bei einem historischen Längsschnitt zum Thema Kriegsfotografien eignen. Zum Schluss einer solchen Reihe kann reflektiert werden, ob die Armeniergräuel von 1915 ein Völkermord waren. Ein Vergleich mit anderen Völkermorden in der Geschichte im Rahmen einer entsprechenden Reihe, wie es etwa im brandenburgischen Lehrplan anklingt, wäre ebenfalls denkbar.
Der rheinland-pfälzische Lehrplan für das Fach Geschichte als Leistungskurs in der Sekundarstufe II bietet „eine große Offenheit in der Themenwahl und einen weitgefassten Freiraum in der thematischen Gestaltung“ (Lehrplan, Sek. II, S. 57). Dabei werden neben der chronologischen Orientierung im Grundfach zusätzliche „Wahlbereichsthemen“ angeboten.
So wird als übergreifendes Thema „Deutschland und Polen im Wandel der Beziehungen“ vorgeschlagen (Lehrplan, Sek. II, S. 66f). Denkbar wäre auch ein historischer Längsschnitt zu „Deutschland und Türkei im Wandel der Beziehungen“. Dabei könnte der Wandel der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen beider Länder seit dem 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart erforscht werden. Mit Hilfe eines solchen Längsschnittes kann der Wandel der deutsch-türkischen Wahrnehmungen, ihrer wechselseitigen Beziehungen und Konfrontationen aufgrund der politischen und kulturellen Rahmenbedingungen im Unterricht analysiert werden. So können beispielsweise die „Türkenpredigten“ verdeutlichen, wie das Osmanische Reich und seine Expansion in der Frühen Neuzeit von der katholischen Kirche und den etablierten Mächten Zentraleuropas als Gefahr für das Christentum angesehen und propagiert wurde. Beispiele aus Architektur, Mode, Malerei („La Turquerie“) oder Musik (Mozart: Die Entführung aus dem Serail; Puccini: Madama Butterfly, Turandot) lassen wiederum erkennen, wie seit dem 17. Jahrhundert eine Faszination für den Orient existierte. Die wirtschaftlichen, militärischen und politischen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert, ihre militärische Zusammenarbeit im Ersten Weltkrieg, die Republik Türkei als Exil für deutsche Flüchtlinge wie Ernst Reuter als auch die wirtschaftlichen Verträge in der Nachkriegszeit (Stichwort „Gastarbeiter“) haben zur gegenwärtigen wechselseitigen Wahrnehmung beigetragen und können parallel auch im Fach Sozialkunde (beispielsweise zur Frage des EU-Beitritts der Türkei) näher beleuchtet werden.
Ähnliche Längsschnitte könnten sich etwa auch der Geschichte christlich-muslimischer Beziehungen widmen und dabei konfliktarmen wie auch konfliktreichen Themen (etwa den aufeinander bezogenen Vorstellungen von heiligen Kriegen; dazu unten ein Materialhinweis) nachgehen.
Ein solcher Längsschnitt kann dazu beitragen, gegenwärtige islamophobe Bewegungen in der deutschen Gesellschaft reflektieren zu können und ihre Folgen zu diskutieren (moralisches Geschichtsbewusstsein, fächerübergreifend mit Ethik/Philosophie).
Fächerübergreifender Geschichtsunterricht?
Die Möglichkeiten eines fächerübergreifenden historischen Lernens sind sicher zahlreich, hängen aber in starkem Maß vom Kollegium an einer konkreten Schule und den Spielräumen dort ab. Wir können nur Ideen vorstellen, was möglich wäre. Denkbar wäre etwa eine Zusammenarbeit mit dem Deutschunterricht. Hier hat Arne Lietz schon 2008 vorgeschlagen.
„Der Völkermord an den Armeniern lässt sich ebenfalls im Deutschunterricht der gymnasialen Oberstufe behandeln. Sowohl der historische Roman von Franz Werfel „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ (1933) als auch der Roman von Edgar Hilsenrath „Das Märchen vom letzten Gedanken“ (1989) wären hier zu nennen. […] Ein Gymnasiallehrer aus Berlin, der im Fach Deutsch die Thematik mit seinen Schülern behandelte, lud zum Abschluss der Unterrichtseinheit Referenten ein und organisierte mit den Schülern eine Ausstellung an der Schule. Das Interesse und die Mitarbeit der Schüler waren unerwartet hoch.“ (Lietz, Arne: Der Armenische Genozid als Unterrichtsgegenstand in der Bundesrepublik Deutschland. In: Aufklärung, Bildung, "Histotainment"? Zeitgeschichte in Unterricht und Gesellschaft heute. Hrsg. v. Michele Barricelli. Frankfurt/Main u.a. 2008, S. 237–246.)
Tatsächlich dürfte vor allem Edgar Hilsenraths "Das Märchen vom letzten Gedanken", dessen Inszenierung 2014 in Konstanz auf so viel Widerstand traf, ein guter Ansatzpunkt etwa für die Frage sein, wie sich die massenhafte Vernichtung von Menschen erzählen lässt - und wie die Herausforderung der Shoa für dieses Erzählen in ein Märchen über das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg mündet.
Vorstellbar wäre aber auch eine Kooperation mit dem Politik-/Sozialkundeunterricht. Auch hier hat Lietz einen Vorschlag gemacht:
„Die völker- und menschenrechtliche Thematik, die mit dem des Genozid an den Armeniern verbunden ist, kann auch im Fach Politische Weltkunde [= Sozialkunde] behandelt werden. […] Zum einen bieten die Vorgänge […] einen Zugang zur Untersuchung der Entwicklung im Internationalen Strafrecht und der Strafverfolgung von Völkermordverbrechen beziehungsweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die Nürnberger Tribunale von 1946 bis hin zur Rolle des heutigen Internationalen Strafgerichtshofes […]. In einer gegenwartsbezogenen Perspektive bietet das Thema auch einen möglichen Einstieg in die Frage, ob die Türkei der Europäischen Union beitreten soll oder kann […].“ (Lietz: Der Armenische Genozid als Unterrichtsgegenstand.)
Beide vorgestellten Themen sind denkbare Ansätze. In beiden würde es etwa um die Frage gehen, welche Rolle Moral und Ethik in den internationalen Beziehungen spielen dürfen: Sind Eingriffe in innerstaatliche Angelegenheiten wie im heutigen Völkerstrafrecht selbstverständlich gut und wichtig, oder gibt es nachvollziehbare Gründe dafür, dass diese Art des Eingriffs lange nicht vereinbart werden konnte und die Staatengemeinschaft heute noch spaltet? Wieso gab es etwa 1918/19 kein internationales Gericht in Konstantinopel? Und wer darf von der Türkei heute im Hinblick auf den EU-Beitritt die Anerkennung des Geschehens als Völkermord fordern - und in welcher Beziehung stehen hier Geschichtspolitk und die Gestaltung moderner internationaler Beziehungen in Europa?
Das alles sind noch recht naheliegende Ansätze. Hinzu kämen auch Überschneidungsbereiche wie in der Musik (wo man Arrangements, Inszenierung und Auftritt von "System of a Down" analysieren könnte) oder in der Kunst (im Hinblick auf die künstlerische Aneignung der massenhaften Vernichtung von Menschen).
Material
Der Geschichtsunterricht lebt von aussagekräftigen Quellen. Für den Bereich der Armeniergräuel können solche Quellen leicht gefunden werden. Denkbar hier wären etwa:
- http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/WebStart-De?OpenFrameset (Datenbank von professionell aufgearbeiteten Quellen vor allem aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes zum Völkermord und seiner Vorgeschichte; enthält auch eine kritische Ausgabe der sog. Lepsius-Edition sowie Unterrichtshinweise)
- Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (Hg.), Ein verdrängter Genozid im 20. Jahrhundert? (= Geschichte für heute, Bd. 6.2013,3). Mit Beiträgen von Joachim Cornelißen u.a., Schwalbach/Ts 2013 (vor allem S. 21)
Vom Fokus her weiter und insgesamt entlang der deutsch-türkischen Beziehungs- und Verflechtungsgeschichte enthält die folgende Handreichung gute Quellen:
- Gisbert Gemein u. Metin Oezsinmaz, Deutsche und Türken in der Geschichte (= Geschichte, Politik und ihre Didaktik Sonderheft, Bd. 8), Münster 2001.
Das ZDF hat in einer Reihe zum Thema zum Thema "Heiliger Krieg" auch eine Folge zum Thema "Dschihad für den Kaiser. Kampf der Kolonialmächte um Vormachtstellung im Orient" gezeigt. Die Folge und begleitende Materialien für Geschichtslehrerinnen wurden vom ZDF online zur Verfügung gestellt:
- Der Heilige Krieg (4/5): Dschihad für den Kaiser. Kampf der Kolonialmächte um Vormachtstellung im Orient. Sendung vom 28.08.2011. URL: http://www.zdf.de/heiliger-krieg/dschihad-fuer-den-kaiser-5445536.html (20.05.2015).